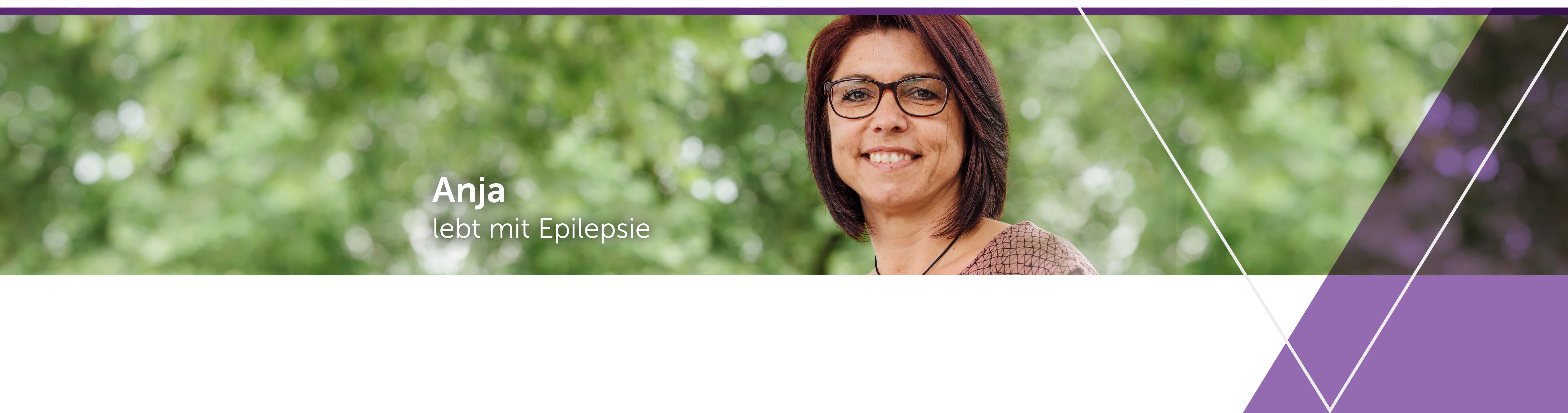Die beste Vorbeugung gegen eine schwere Lebenskrise sind eine gute Behandlung und ein sicheres soziales Umfeld. Vertrauen Sie sich und Ihre Sorgen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Epilepsie-Erkrankung haben, nahestehenden Mitmenschen an oder suchen Sie Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe, einer Epilepsieberatungsstelle oder einer Spezialklinik für Epilepsie.
Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person depressiv sind, unter einer schweren Lebenskrise leiden oder Selbstmordgedanken haben, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111 oder 800-1110222. Hier erhalten Sie kostenlose Hilfe von Berater:innen, die Ihnen Auswege aus verzweifelten Situationen aufzeigen können und professionelle Hilfe vor Ort vermitteln.