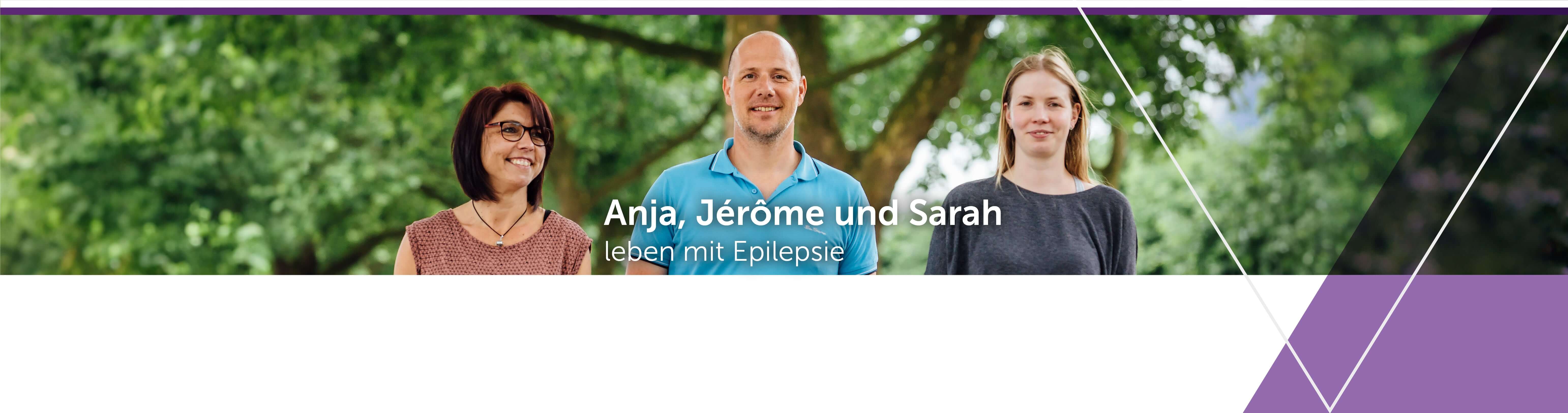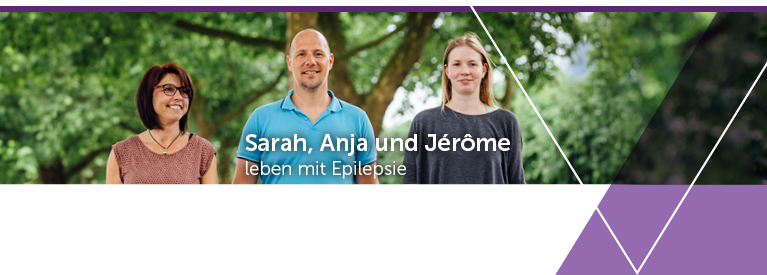Vor der Schwangerschaft
Fakt ist, dass Epilepsie nur selten vererbt wird: So erkranken mehr als 95 % der Kinder epilepsiebetroffener Eltern nicht an einer Epilepsie. Umgekehrt entwickelt 1 % aller Kinder, deren Eltern keine Epilepsie haben, im Laufe des Lebens ein Anfallsleiden. Entsprechend kann das Risiko, die Erkrankung an seine Kinder weiterzugeben, als nur leicht erhöht bezeichnet werden. Tritt Epilepsie in der Familie gehäuft auf oder besteht der Verdacht auf eine erbliche Form, könnte eine genetische Abklärung hingegen sinnvoll sein.
Allen Frauen mit Kinderwunsch (und solchen, die ungeplant schwanger werden könnten) empfehlen Gynäkolog:innen die frühzeitige Einnahme von Folsäure. Das B-Vitamin spielt bei allen Prozessen der Zellbildung und -teilung im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Ein Mangel an Folsäure kann unter anderem zu sogenannten Neuralrohr-Defekten beim Kind (z. B. Spina bifida) führen. Das Neuralrohr, aus dem sich später das zentrale und periphere Nervensystem des Kindes entwickelt, wird schon in der zweiten bis dritten Schwangerschaftswoche gebildet und schließt sich in der vierten Woche, wenn Frauen oft noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Daher sollten Frauen mit Kinderwunsch mindestens vier Wochen vor der Schwangerschaft täglich 400 µg Folsäure mit der Nahrung und zusätzlich 400 µg über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, rät der Berufsverband der Frauenärzt:innen. Da einige Epilepsiemedikamente einen Folsäuremangel hervorrufen können, liegt die empfohlene Folsäuredosis für Frauen mit Epilepsie bei 4 bis 5 mg täglich und damit deutlich höher.