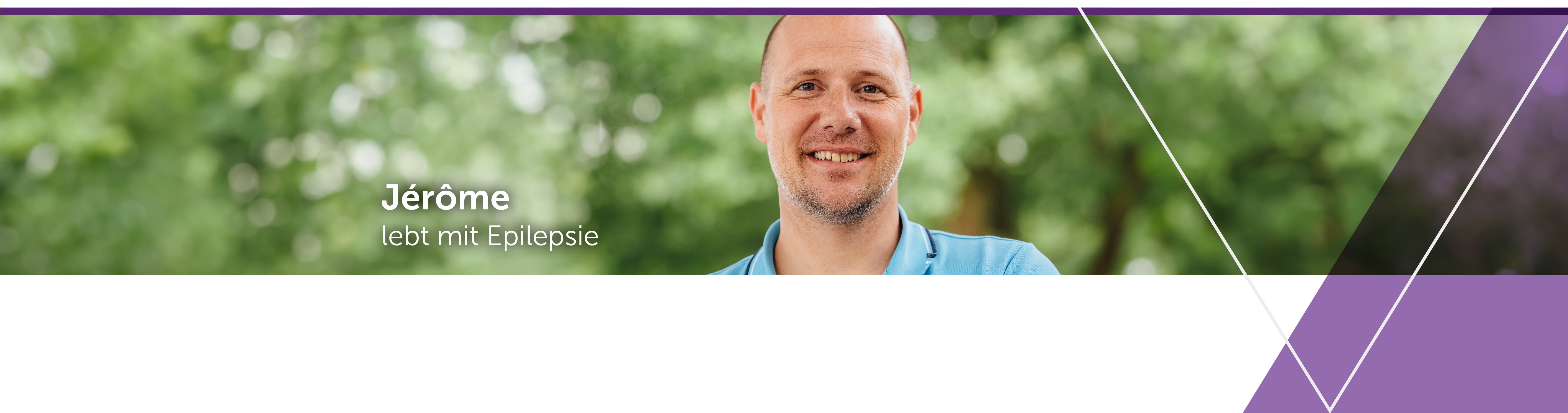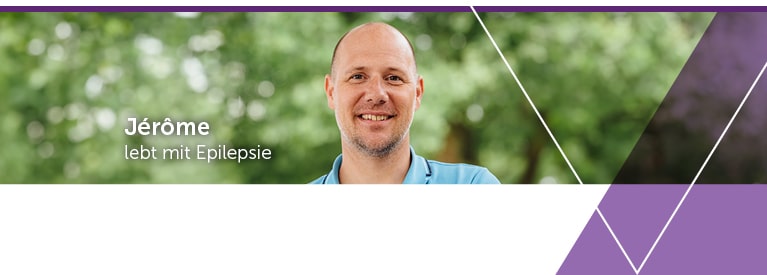Kann Epilepsie geheilt werden?
Das höchste Ziel einer ärztlichen Behandlung ist die Genesung der Patient:innen. Doch wie kann dieses Ziel bei einer neurologischen Erkrankung wie Epilepsie erreicht werden?
Anfallsfreiheit als Behandlungsziel
Die Anfallsfreiheit ist das primäre Ziel der Epilepsie-Behandlung. Dank moderner anfallssuppressiver Medikamente ist bei etwa 70 % der Patient:innen eine gute Anfallskontrolle möglich, wenn sie konsequent die verordneten Medikamente einnehmen. Unter einer guten Anfallskontrolle versteht man dabei eine völlige Anfallsfreiheit oder nur sehr wenige Anfälle bei guter Verträglichkeit des Medikaments bzw. der Medikamente. Wird eine Anfallsfreiheit mit der medikamentösen Behandlung nicht erreicht, dann werden zumindest eine Senkung der Anfallshäufigkeit und eine Verminderung der Anfallsstärke angestrebt.
Häufig bestimmen die Form der Epilepsie und das Alter, in dem sie auftritt, die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Anfallsfreiheit. Bei bestimmten Epilepsien, die in der Kindheit auftreten, zum Beispiel die Rolando-Epilepsie, sind die Chancen besonders hoch.
Absetzen der medikamentösen Therapie – eine individuelle Entscheidung
Laut der aktuellen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (Stand: 2023) kann das Absetzen einer anfallssuppressiven Therapie in Erwägung gezogen werden, wenn Patient:innen mindestens zwei Jahre anfallsfrei sind. Die Entscheidung sollte jedoch individuell getroffen werden, da das Risiko eines Anfallsrezidivs (Wiederauftreten eines epileptischen Anfalls) nach dem Absetzen in den folgenden zwei Jahren bei 40 bis 50 % liegt – etwa doppelt so hoch wie unter fortgesetzter Therapie.
Ob ein Absetzen sinnvoll ist, hängt von verschiedenen klinischen Faktoren sowie den persönlichen Wünschen und Ängsten der Patient:innen ab. Einerseits kann das Beenden der Therapie mögliche Nebenwirkungen oder eine medikationsbedingt empfundene Stigmatisierung verringern. Andererseits muss das individuelle psychosoziale Risiko im Falle eines Anfallsrückfalls bedacht werden, da dieser unter Umständen belastender sein kann als eine fortgesetzte medikamentöse Behandlung. Dabei sollten auch mögliche Auswirkungen eines Anfallsrezidivs auf die Fahrtauglichkeit und berufliche Tätigkeit berücksichtigt werden.
Wann kann ein Absetzen in Betracht gezogen werden?
Eine generelle Empfehlung, wann bzw. bei welchen anfallsfreien Patient:innen die Medikamente abgesetzt werden können, kann nicht gegeben werden. Ob anfallssuppressive Medikamente weggelassen werden können oder nicht, ist also von Patient:in zu Patient:in unterschiedlich und muss stets unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten entschieden werden.
Ein Versuch, die Medikamente schrittweise abzusetzen, kann in enger Abstimmung mit der behandelnden Fachärztin bzw. dem behandelnden Facharzt erfolgen, wenn die Voraussetzungen günstig sind. Dazu zählen unter anderem:
- Lange Anfallsfreiheit über mehrere Jahre
- Kurze Krankheitsgeschichte mit insgesamt wenigen Anfällen
- Schnelles Erreichen der Anfallsfreiheit nach Therapiebeginn
Die gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Ärztin/Arzt und Patientin/Patient spielt eine zentrale Rolle. Dabei sollte das Risiko eines Anfallsrückfalls sorgfältig abgewogen werden. Da anfallssuppressive Medikamente nur symptomatisch wirken und die Ursache der Epilepsie nicht beseitigen, bleibt die grundsätzliche Neigung zu Anfällen bestehen – mit Ausnahme erfolgreicher epilepsiechirurgischer Eingriffe.
DE-DA-2300094
Letzte Aktualisierung: März 2025