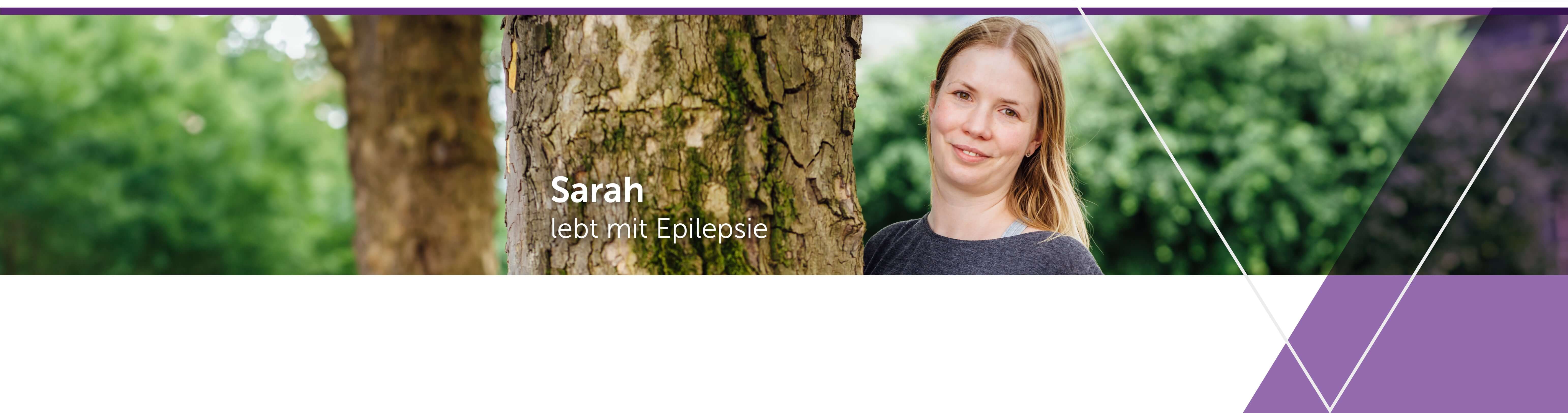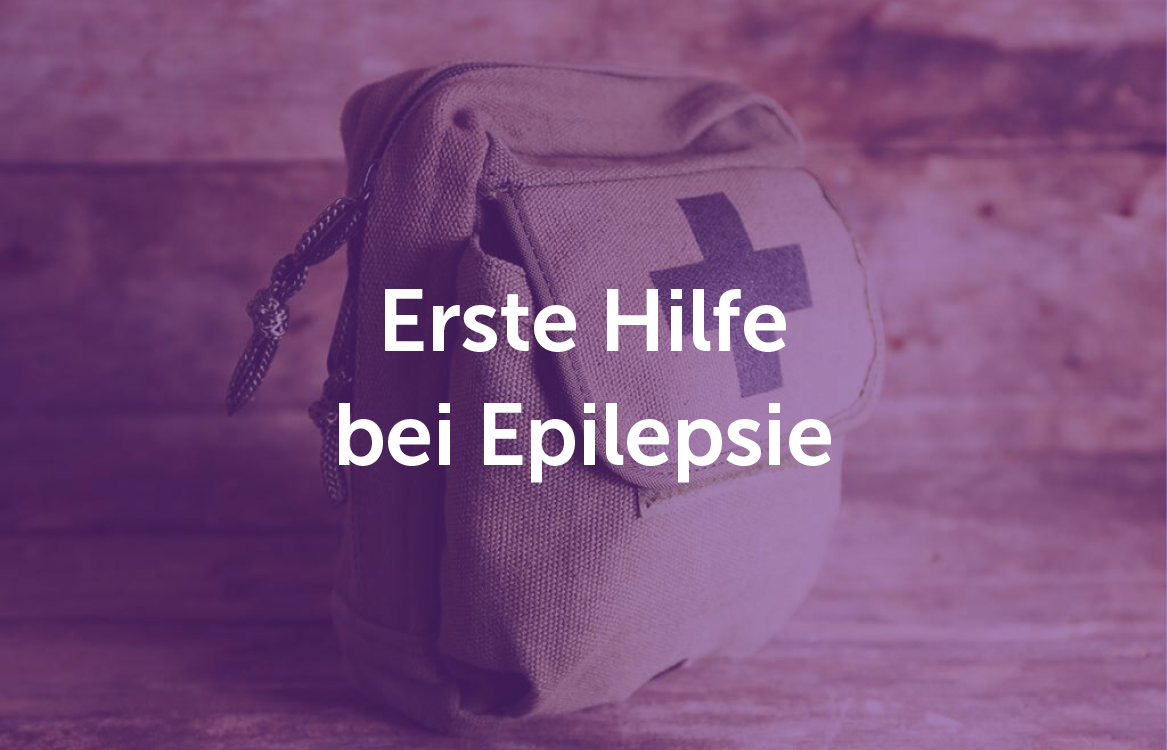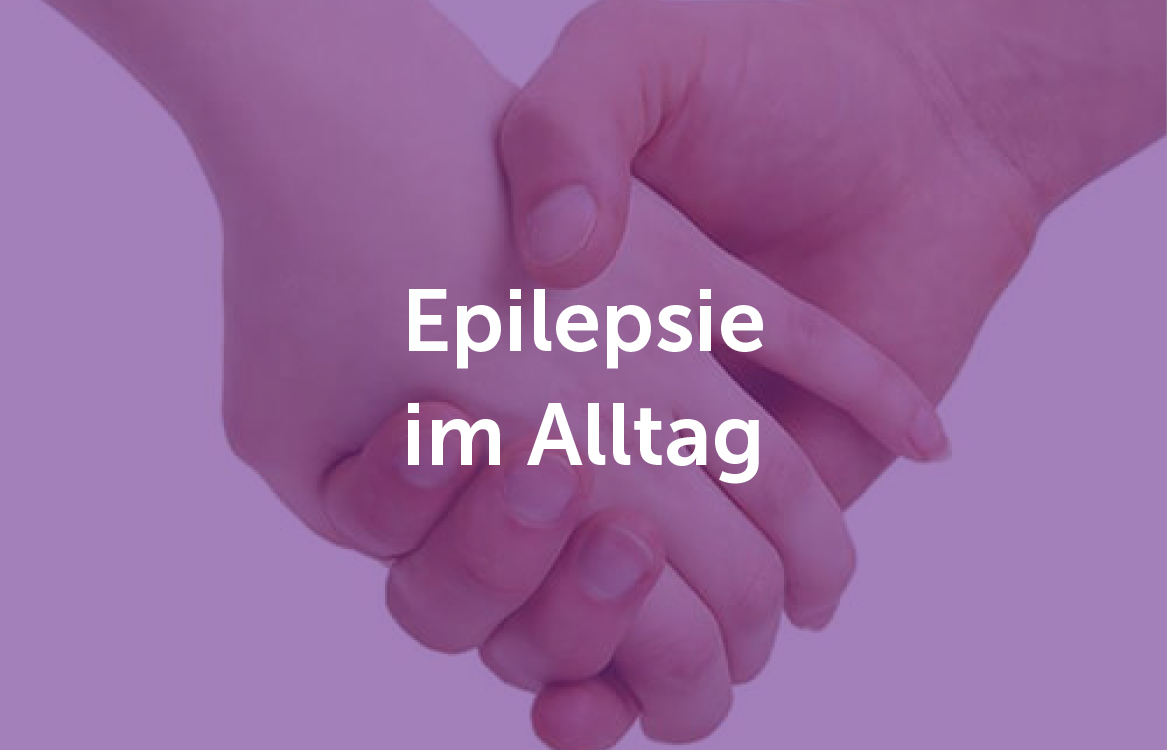Die Angst vor dem nächsten Anfall
Bei Menschen mit Epilepsie treten aus verschiedenen Gründen häufiger Ängste auf. Zum einen gibt es biologische Zusammenhänge zwischen Epilepsie und Angst, z. B. kann Angst direkt als ein Symptom der Epilepsie-Erkrankung selbst auftreten; dies ist vor allem bei Anfällen der Fall, die ihren Ursprung im Schläfenlappen haben (Temporallappen-Epilepsie). Zum anderen kann die Angst ein Ausdruck der psychischen Belastung sein, die mit der Epilepsie-Erkrankung einhergeht. Aber auch die zur Behandlung eingenommenen sogenannten anfallssuppressiven, d. h., anfallsunterdrückenden Medikamente bzw. eine Anpassung dieser Medikamente können Ängste auslösen oder verstärken.
Einige Betroffene fürchten sich vor der Unvorhersehbarkeit der Anfälle. Bei anderen Betroffenen kann die Angst zu plötzlichen Panikattacken führen. Diese äußern sich neben dem Angstgefühl in körperlichen Beschwerden wie Atemnot, Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Übelkeit, Schwindel oder Hitzewallungen. Für die Diagnose und gezielte Therapie von Angststörungen können neben der behandelnden Ärztin/dem behandelnden Arzt auch eine Psychologin/ein Psychologe aufgesucht werden. Bei einigen Patient:innen kann darüber hinaus eine medikamentöse Therapie in Betracht gezogen werden.