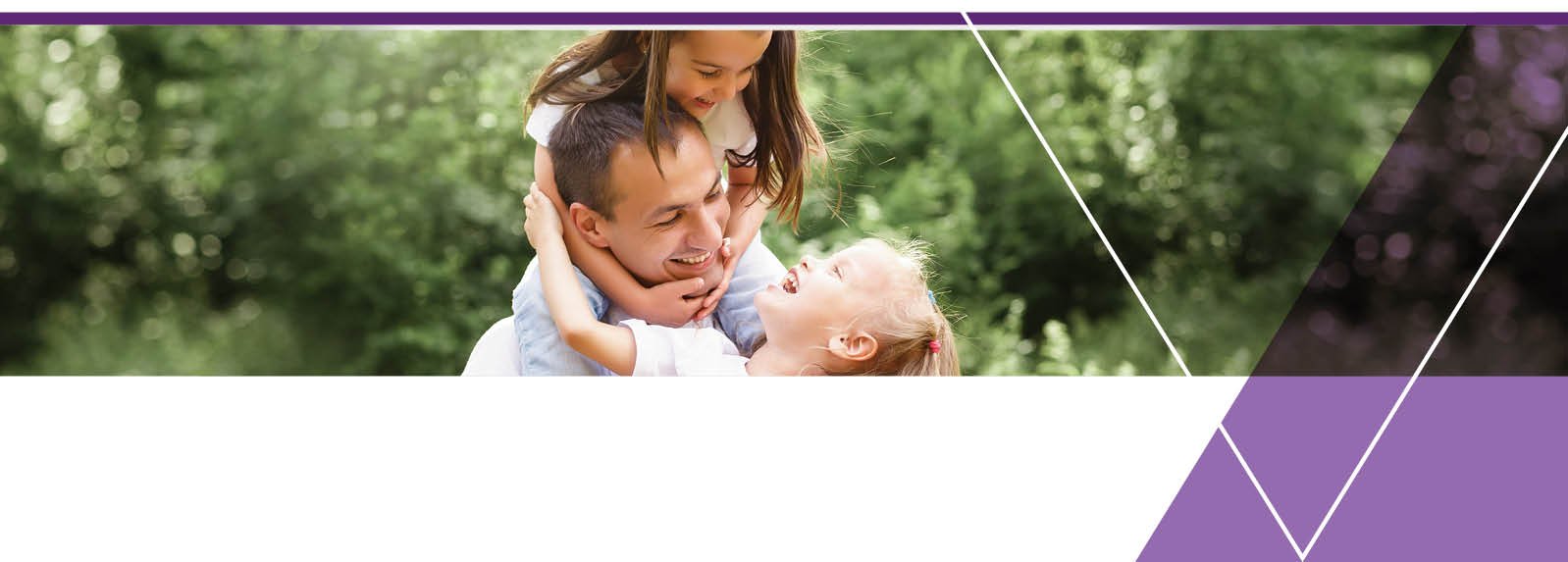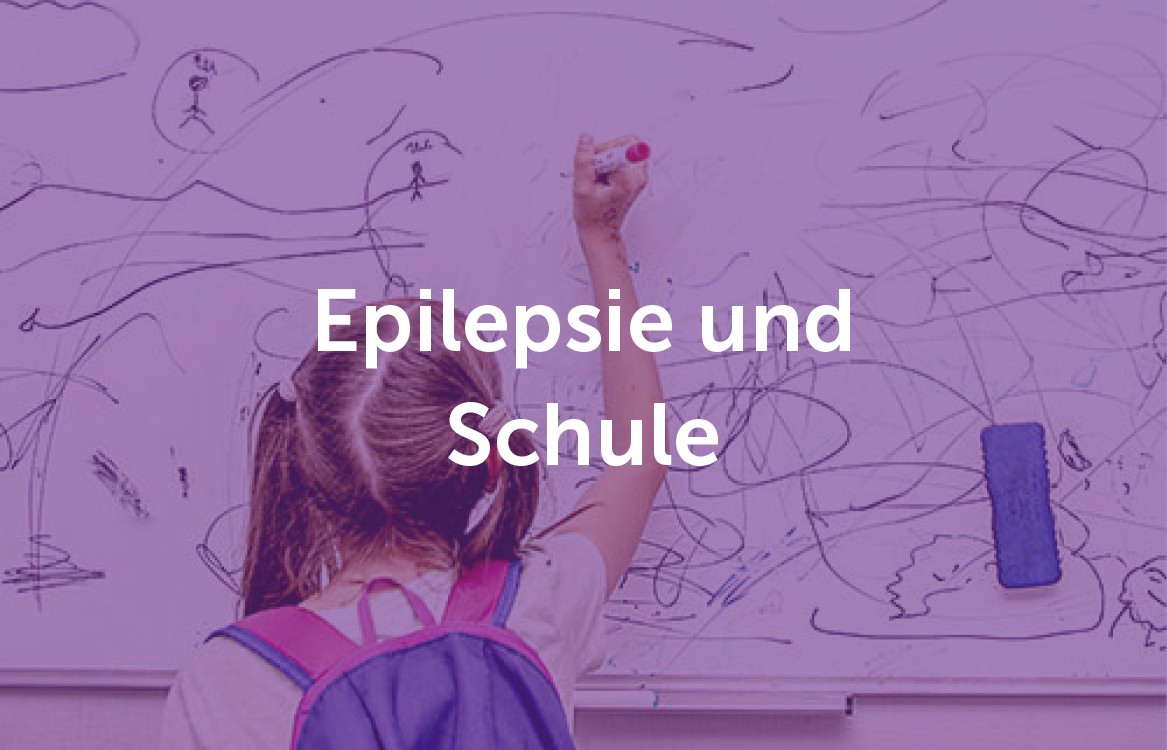Eine Epilepsie kann von Geburt an bestehen oder sich erst im Laufe des Lebens entwickeln. Es gibt allerdings zwei Altersabschnitte, in denen besonders häufig Epilepsien zum ersten Mal auftreten: zum einen in den ersten Lebensjahren und zum anderen nach dem 60. Lebensjahr. Man nimmt an, dass ca. 5 % der Bevölkerung mindestens einmal im Leben einen epileptischen Anfall erleiden, ohne jedoch eine Epilepsie zu entwickeln. Etwa 4 bis 10 % aller Kinder und Jugendlichen haben irgendwann einen epileptischen Anfall, wie zum Beispiel einen Fieberkrampf, einen akut symptomatischen Anfall (ASA) oder einen unprovozierten epileptischen Anfall (siehe auch Epilepsien und Anfallsformen im Kindesalter). Im Alter von 20 Jahren ist jedoch nur bei 1 % die Diagnose einer Epilepsie gestellt.
Epilepsie ist dabei nicht gleich Epilepsie; daher können auch die Auswirkungen auf das Alltagsleben bei jeder Patientin und jedem Patienten unterschiedlich sein. Voraussetzung für die Prognose ist die genaue Diagnose der Erkrankung. Je nach Form der Epilepsie oder des Epilepsie-Syndroms und dem Krankheitsverlauf kann dann die individuell optimale Behandlung erfolgen.