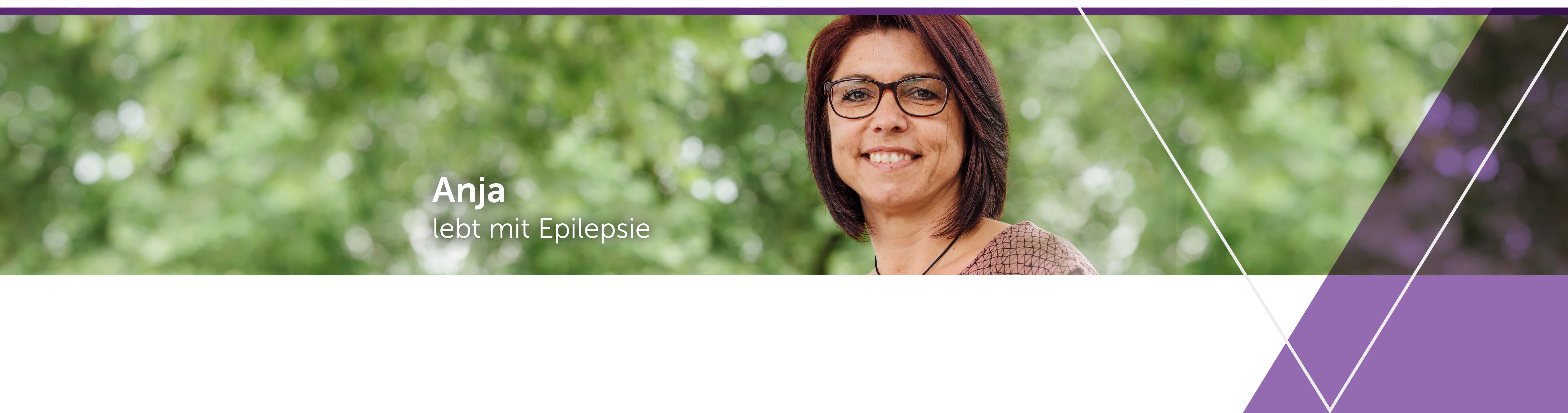Die Schwierigkeiten bei der Therapie der Erkrankung, das Fortbestehen von Anfällen, die zu Stürzen führen können, und die kognitiven Beeinträchtigungen führen dazu, dass Patient:innen mit Lennox-Gastaut-Syndrom häufig kein selbstständiges Leben führen können und lebenslang auf Unterstützung angewiesen sind. Dies beeinträchtigt nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen erheblich, sondern auch die ihrer Familien.
Eine umfassende Behandlung des Lennox-Gastaut-Syndroms sollte daher nicht nur darauf abzielen, die Anfälle medikamentös zu kontrollieren, sondern auch die kognitiven und Verhaltensprobleme, Schlafstörungen, körperlichen Behinderungen, sozialen Beeinträchtigungen sowie schulischen und beschäftigungsspezifischen Herausforderungen interdisziplinär zu adressieren und damit die Lebensqualität der Betroffenen und deren Angehöriger zu verbessern. Da sich die bei Kindern noch eher „typischen“ Symptome des Lennox-Gastaut-Syndroms im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verändern und bei erwachsenen Patient:innen Anfallsformen auftreten können, die über die beim Lennox-Gastaut-Syndrom häufigsten Typen hinausgehen, ist es wichtig, die Therapie immer wieder zu hinterfragen und eventuell anzupassen.
Hilfreiche Tipps sowie Unterstützung zum Umgang mit der Diagnose und Erkrankung Epilepsie und nicht zuletzt das Gefühl, nicht allein zu sein, finden Angehörige und Betreuende auf der Webseite des e.b.e. Epilepsie-Bundeselternverbands. Auf der englischsprachigen Webseite der US-amerikanischen LGS-Foundation gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, sich über Fortschritte in der LGS-Forschung zu informieren.
Viele wichtige Informationen und praktische Tipps zum Umgang mit der Erkrankung finden Sie auch in unserer Informationsbroschüre „Das Lennox-Gastaut-Syndrom“, die Sie hier abrufen können.