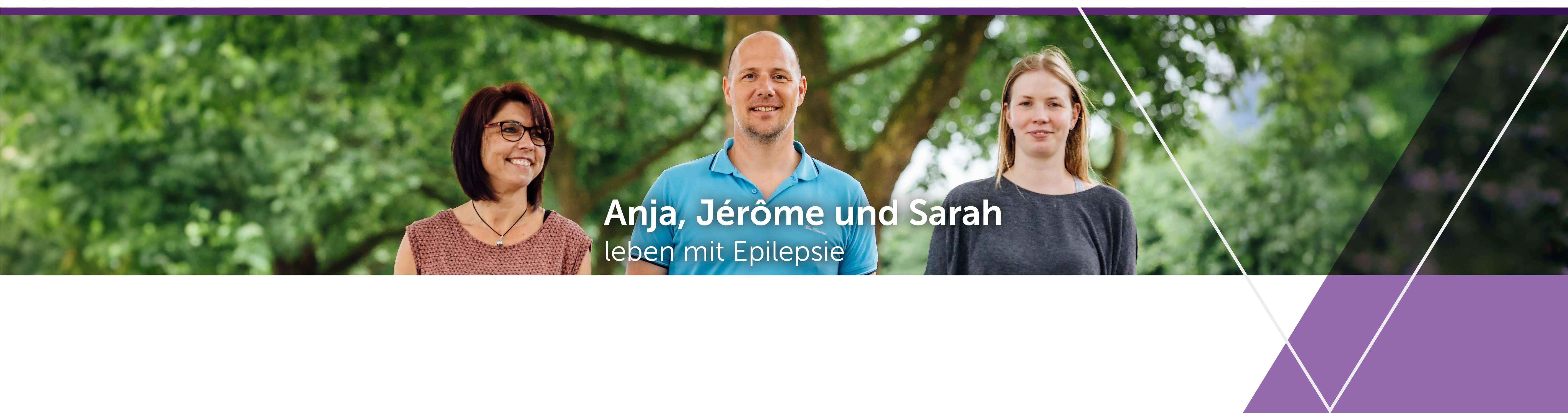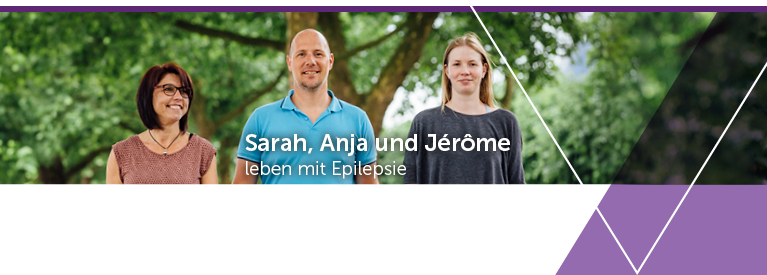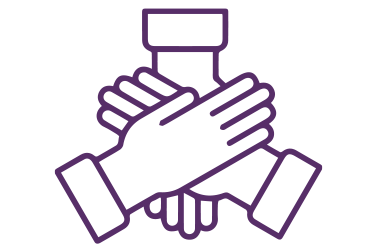„In Deutschland können Jugendliche bis zum Abschluss ihrer körperlichen Entwicklung von Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin betreut werden. Mit dem 18. Geburtstag (in Ausnahmefällen auch später) muss dann in der Regel ein Wechsel in die erwachsenenorientierte Gesundheitsversorgung stattfinden.“
S3-Leitlinie‚ „Transition von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin“
- epilepsie bundes-elternverband e. V. (e.b.e.)
Auf der Seite der Patientenorganisation epilepsie bundes-elternverband e. V. (e.b.e.) finden sich Informationen zu Schulungsprogrammen speziell für Kinder/Jugendliche mit Epilepsie und deren Familien. - Kompetenznetz Patientenschulung im Kindes- und Jugendalter e. V. (KomPaS)
Das Kompetenznetz Patientenschulung im Kindes- und Jugendalter e. V. (KomPaS) bietet Transitionsworkshops für chronisch kranke Jugendliche und ihre Eltern für eine Vielzahl chronischer Erkrankungen an. Unter den Web-Links between-kompas.de und between-elterncoach.de finden junge Patient:innen und deren Angehörige zudem Informationen zu Themen wie erste Liebe, Berufswahl, Erziehungsfragen oder sozialrechtliche Änderungen - und können im Expertenrat eigene Fragen stellen. - Berliner TransitionsProgramm (BTP)
Die Transitionsbegleitung nach dem Konzept des Berliner TransitionsProgramms (BTP) wird in Deutschland von verschiedenen Transitionsstellen angeboten. Kontaktinformationen sind auf btp-ev.de unter dem Menüpunkt „Transitionsstellen“ zu finden.