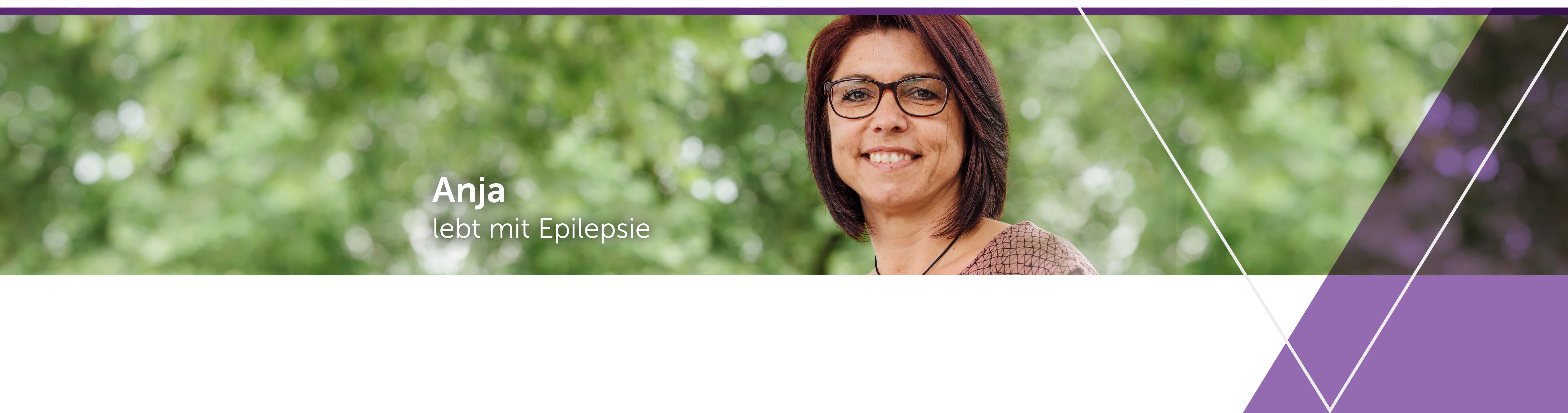Fieberkrämpfe, die im Rahmen von fieberhaften, meist viralen Infektionskrankheiten auftreten, zählen zu den häufigsten Notfällen im Kindesalter. Von den Eltern wird ein solcher Anfall als extrem beängstigend und bedrohlich für das Kind empfunden. In den allermeisten Fällen bleibt er aber ohne gesundheitliche Folgen für das Kind – der Fieberkrampf gilt im medizinischen Sinne als in aller Regel harmlos, auch wenn er, vor allem beim ersten Auftreten, die Verständigung des Notarztes notwendig macht.
Dauert der Anfall ungewöhnlich lange (länger als 20 Minuten) und ist er nur schwer zu durchbrechen, kann dies auf ein seltenes Epilepsie-Syndrom, nämlich das Dravet-Syndrom, hinweisen. So gilt eine schnelle Erhöhung der Körpertemperatur als der häufigste auslösende Faktor (Trigger) für Anfälle, die das Dravet-Syndrom charakterisieren. Entsprechend zeigen sich diese meist schon bei Säuglingen im Alter zwischen drei und neun Monaten, die sich zuvor gesund und altersgerecht entwickelt haben. Weitere, im Verlauf der Erkrankung ebenfalls wichtige Auslösefaktoren für Anfälle sind u. a. starke Emotionen wie Aufregung, Wut oder Stress, Schlafmangel, starke körperliche Anstrengung, Infekte (auch ohne Anstieg der Körpertemperatur) sowie schnelle Licht-/Schattenwechsel oder auffällige Muster.
Das Dravet-Syndrom ist eine seltene, aber schwere Form einer entwicklungsbedingten und epileptischen Enzephalopathie. Ursache des Dravet-Syndroms, das etwa eines von 20.000 lebend geborenen Kindern betrifft, ist in rund 85 Prozent der Fälle eine Veränderung (Mutation) im sogenannten SCN1A-Gen, das für die Ausbildung eines Ionenkanals in Nervenzellen kodiert. Durch die Mutation ist dieser Ionenkanal in seiner Funktion beeinträchtigt. Da er vor allem bei hemmenden Nervenzellen vorkommt, können diese ihre Aufgabe nicht mehr ausreichend erfüllen, wodurch es in bestimmten Gehirnbereichen zu Übererregbarkeit kommt, die wiederum zu einer Anfälligkeit für epileptische Anfälle führt. In nur zehn Prozent der Fälle wird eine Vererbung durch ein Elternteil festgestellt, bei 90 Prozent der betroffenen Kinder tritt diese Veränderung neu auf.